Trialog: Brücken bauen an der Universität Heidelberg mit Dr. Uri Rosenberg
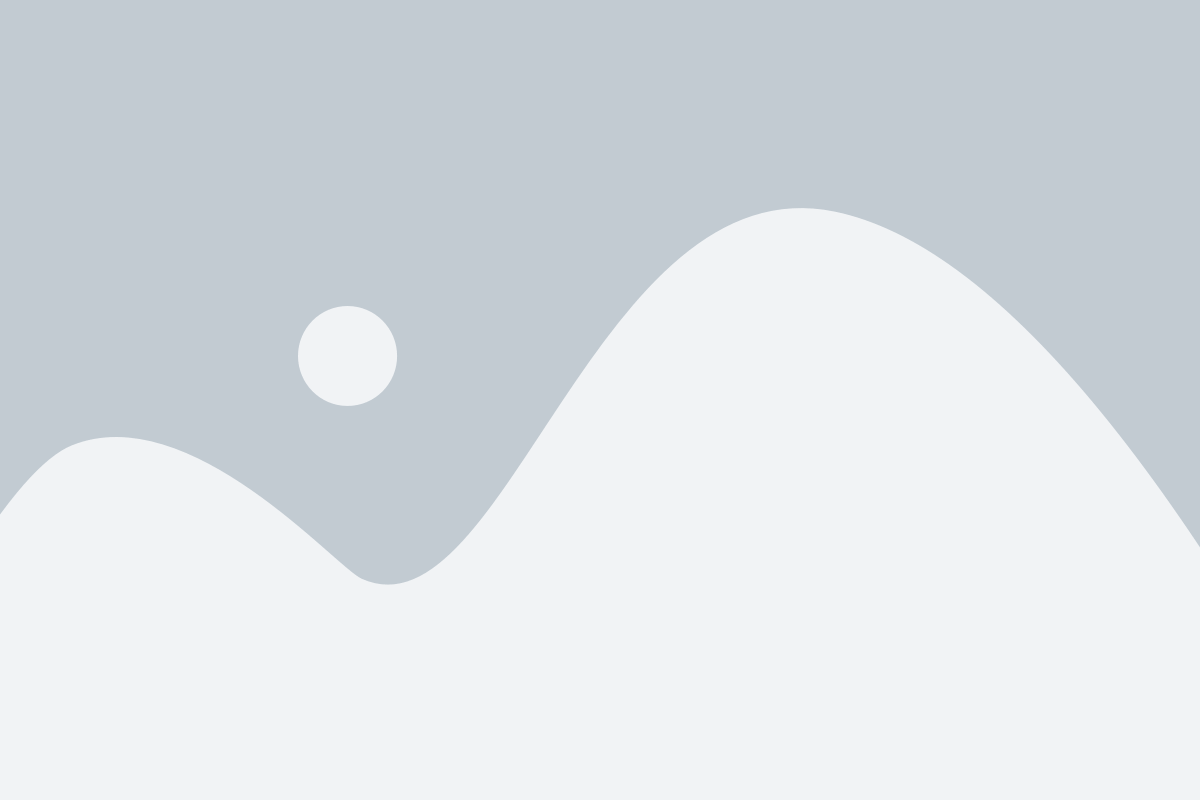
Dank der Unterstützung durch das Stipendium des Netzwerks Israel konnte Dr. Uri Rosenberg eine Trialog-Workshop-Woche an der Universität Heidelberg umsetzen, wo er derzeit als Gastprofessor tätig ist. Für eine Woche kamen fast 50 junge Menschen aus Israel, Palästina und Deutschland an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Dieser Workshop entstand aus einer gemeinsamen Idee von Dr. Uri Rosenberg, Mitbegründer der israelisch-palästinensischen NGO Tech2Peace, und Tom Khaled Würdemann, strukturierten israelisch-palästinensischen Dialog nach Deutschland zu bringen. Dr. Rosenberg hatte schon lange die Vision, Dialogarbeit in einen dritten Raum zu verlagern, also außerhalb des direkten regionalen Drucks und gleichzeitig die deutsche Gesellschaft stärker einzubeziehen.
Ziel war es nicht nur, Dialog in einem physisch sicheren Umfeld zu ermöglichen, sondern auch zu adressieren, wie der israelisch-palästinensische Konflikt in Deutschland nachhallt, insbesondere durch konkurrierende Solidaritäten und widersprüchliche Identifikationen mit Israel und Palästina.
Die Idee entwickelte sich zu einem Trialog Modell: Nicht nur israelische und palästinensische Teilnehmende, sondern auch Deutsche mit unterschiedlichen Hintergründen sollten zusammenkommen. Dies verfolgte zwei parallele Ziele: Erstens sollten deutsche Personen, von denen viele emotional oder politisch in den Konflikt involviert sind, jedoch selten Kontakt zu betroffenen Menschen von beiden Seiten haben, die Möglichkeit erhalten, direkt mit gelebten Erfahrungen in Berührung zu kommen. Zweitens sollte israelischen und palästinensischen Teilnehmenden die Gelegenheit gegeben werden, mitzubekommen, wie ihr Konflikt und politische Diskurse außerhalb der Region entstehen. Im besten Fall sollte dieses Setting allen Beteiligten ermöglichen, die Fähigkeiten und das Bewusstsein zu entwickeln, die sie benötigen, um als Brückenbauer in ihren jeweiligen Gesellschaften zu wirken.
Das Seminar erstreckte sich über eine volle Woche und verband akademische Perspektiven, strukturierten Dialog und kulturelles Programm, um den israelisch-palästinensischen Konflikt und seine Resonanzen in Deutschland zu erkunden. Das Programm war so gestaltet, dass es im Verlauf an Dynamik gewann, von ersten informellen Begegnungen über tiefgehende, strukturierte Dialoge bis hin zu gemeinsamer akademischer Auseinandersetzung. So konnten die Teilnehmenden schrittweise von Verbindung und Neugier zu kritischer Reflexion und gemeinsamer Recherche gelangen.
Diese Rahmung half dabei, den Ton für eine Woche des Dialogs zu setzen, die von Empathie, Neugier und gegenseitiger Verantwortung getragen wurde.
Viele der Teilnehmenden hatten familiäre Verbindungen zu Israel oder Palästina, manche leben in Berlin, andere kamen direkt aus Tel Aviv, Ramallah oder Ostjerusalem. Gemeinsam sprachen sie über ihre Perspektiven auf den Konflikt, über persönliche Erfahrungen mit Gewalt, Angst, Ohnmacht. Bei dem Workshop ging es um das Miteinander ins Gespräch zu kommen, das war in Teilen auch anstrengend, herausfordernd, teilweise auch schmerzhaft.
Ein abschließender Gesprächskreis, in dem die Teilnehmenden Raum hatten, offen und oft emotional über ihre bedeutendsten Momente aus dem Dialogprozess zu sprechen, teilten einige persönliche Wendepunkte oder unerwartete Verbindungen; andere äußerten offene Fragen, Frustration oder ein erneuertes Gefühl von Sinn und Motivation. Viele reflektierten darüber, wie das Seminar ihre Annahmen herausgefordert oder ihnen geholfen hatte, Menschen besser zu verstehen, die sie zuvor als „Gegenspieler“ wahrgenommen hatten.
Trotz aller Herausforderungen beschrieben die Teilnehmenden in der Auswertung das Seminar überwiegend als wirkungsvoll, augenöffnend und wertvoll. Viele berichteten von einer vertieften Empathie, emotionalen Durchbrüchen und langfristiger persönlicher Weiterentwicklung. Besonders transformativ war die Erfahrung für die deutschen Teilnehmenden, von denen mehrere angaben, sich stärker mit den Realitäten des Konflikts verbunden zu fühlen und besser darauf vorbereitet zu sein, sich mit seinen komplexen Dimensionen im deutschen Kontext auseinanderzusetzen.
Eine Teilnehmerin schrieb: „Dieser Workshop hat mich an meine Grenzen gebracht, es war unbequem, emotional und absolut notwendig.“
Die Sitzung endete mit einer Diskussion darüber, wie die Teilnehmenden das Erlebte weitertragen möchten, sei es in ihrer beruflichen Arbeit, ihrer akademischen Forschung, ihrem Aktivismus oder in ihrem persönlichen Leben. Ein Teil des Gesprächs drehte sich darum, wie man weiterhin engagiert bleiben und wie ein zukünftiges Tech2Peace-Germany-Seminar gestaltet werden könnte, wobei sich einige Teilnehmende bereit erklärten, ein solches Seminar zu leiten.
Viele Teilnehmende berichteten von Momenten, die sie so nicht erwartet hätte, ein Satz, der hängen blieb. Eine Begegnung, die Perspektiven verschoben hat.
Eine Vision, die Uri Rosenberg mit seiner Arbeit seit Jahren verfolgt: Räume für Begegnung schaffen, in denen Menschen einander zuhören, ohne sich einig sein zu müssen.
Schon jetzt ist ein weiteres Seminar für den Winter 2025 in Berlin geplant.
Wo sie unterstützen können


